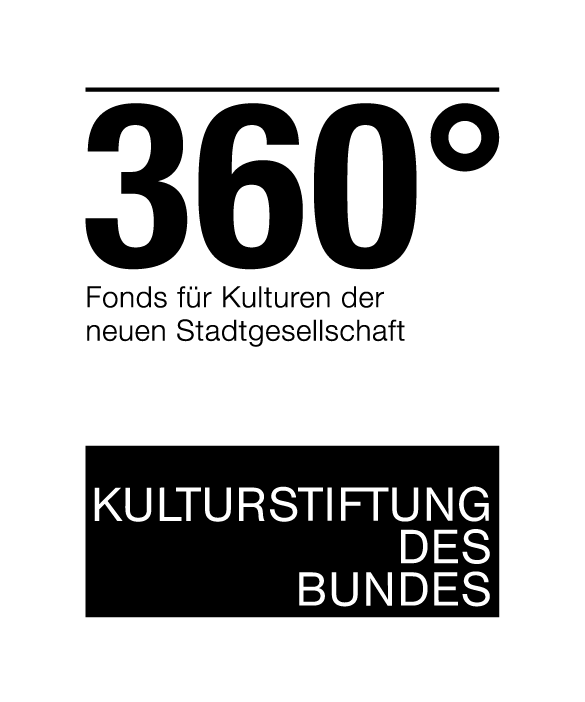filmreihe
lebenswege
lebenswege
Mit unserer Reihe „Lebenswege“ wollen wir euch Biographien von Menschen vorstellen, die im Zuge des Anwerbeankommens zwischen Deutschland und der Türkei nach Bremen gekommen sind.
alİ denİz
Halİl Yilmaz
kemal zeytİn
mevlüt Şenokur
yildiz saraÇ–
bİrnaz kaya
Hayat Yildirim
davut kirca
Mİnas kaya
tuncer mİskİ
Feierstunde für „Gastarbeiter*innen“ am 1. september 2020 im Museumspark bremen
Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte ehrt Lebensleistungen der Arbeitsmigrant*innen der ersten Generation im Focke-Museum.
Ab den 1950er-Jahren kamen Tausende von Menschen aus dem Mittelmeerraum in die Bundesrepublik und damit auch nach Bremen und Bremerhaven, um sich eine neue berufliche Existenz aufzubauen. Den im Zuge des „Wirtschaftswunders“ in der Bundesrepublik und auch in Bremen wachsenden Bedarf an Arbeitskräften versuchte man durch Abkommen mit Anrainerstaaten des Mittelmeers zu befriedigen. Nach dem Anwerbeabkommen mit Italien, das 1955 in Kraft trat, und den Abkommen mit Spanien und Griechenland 1960 wurde die Bundesrepublik 1961 mit der Türkei ein weiteres Mal in Südeuropa fündig. Es folgten Verträge mit Marokko (1963), Portugal (1964) und Tunesien (1965) sowie 1968 mit Jugoslawien.
In Bremen wurden die sogenannten „Gastarbeiter“ bei den Werften Bremer Vulkan und AG „Weser“ sowie bei den Stahlwerken und der Bremer Wollkämmerei dringend gebraucht. Sie kamen zumeist aus der Türkei, Italien und dem ehemaligen Jugoslawien und vor allem in den Stadtteil Gröpelingen.
Am 1. September 2020 wurde die Lebensleistung der Arbeitsmigrant*innen der ersten Generation im Focke-Museum geehrt. Veranstalter waren die Anneliese-Loose-Hartke-Stiftung und das Focke-Museum. Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte hielt eine Laudatio ebenso wie die Bestsellerautorin Ferda Ataman. Ihr Buch „Ich bin von hier. Hört auf zu fragen!“ löste 2019 eine Debatte über Zugehörigkeit aus. Im Anschluss wurden „Zeitzeugeninterviews“ vom Filmemacher Orhan Calışır und Dirk Meißner gezeigt.
Die Ehrung steht im Zusammenhang eines Projekts, das verschiedene Bremer Akteur*innen ins Leben gerufen haben. Sie wollen die Entwicklung der Arbeitsmigration in Bremen aufzeigen und die Geschichten der Bremer*innen mit Einwanderungsbezug inhaltlich aufarbeiten. Ziel des Projekts ist es, die Anwerbung von Migrant*innen für den deutschen Arbeitsmarkt ab den 50er Jahren als integralen Bereich der jüngeren Stadtgeschichte zu zeigen und die gesellschaftliche Diversität im heutigen Bremen historisch zu verorten.







rede von ferda ataman
Sehr geehrte Ehrengäste, sevgili onur konuklari,
geehrter Herr Dr. Bovenschulte,
sehr geehrte Damen und Herren,
danke, dass Sie diese Feierstunde im Park des Focke Museums veranstalten. Leider ist die Anerkennung von Gastarbeiter*innen und Migranten in Deutschland bislang eher eine Leerstelle und für mich persönlich ist es ein Herzensanliegen, dass sich das ändert. Es ist mir daher eine besondere Freude, heute dabei zu sein.
Weil es eine Feierstunde ist, möchte ich eigentlich nur über schöne Dinge reden. Darüber, wie beeindruckend es ist, dass einst Menschen nach Deutschland kamen und dieses Land bis heute auf wunderbare Weise mitgeprägt haben. Aber es war nicht nur schön. Und ich muss auch Schmerzhaftes ansprechen. Denn davon gehört viel zum Gastarbeiter-Kapitel in unserem Land.
Es fängt an mit dem Begriff: Das Wort „Gastarbeiter“ ist schräg. Wer bitte lässt seine Gäste Toiletten putzen und Akkordarbeit am Fließband verrichten? Oder welche Gäste müssen das Haus, in das sie eingeladen werden, erst aufbauen? Und genau das haben sie getan: sie haben dieses Land mit aufgebaut.
Deutschland, das ist auch Ihr Haus. Es ist auch das Haus meiner Eltern.
Beim Wort „Gastarbeiter“ fühle ich mich bis heute angesprochen – denn „Gastarbeiterkind war früher mein sozialer Status in diesem Land. Meine Eltern hatten sich irgendwo zwischen Fließband und Folklore-Abend in Stuttgart kennengelernt. Mein Vater zählte zur zweiten Generation, seine Eltern waren zum Arbeiten gekommen. Meine Mutter kam 1972 als eine der letzten Gastarbeiterinnen nach Deutschland, kurz vor dem Anwerbestopp. Als Frau gehörte sie zur Leichtlohngruppe, die noch schlechter bezahlt wurde als männliche Gastarbeiter, die schon schlechter bezahlt wurden als einheimische Deutsche.
Wir Gastarbeiterkinder teilen manche Geschichten, ganz gleich, ob unsere Eltern aus Italien, Spanien, Griechenland, Jugoslawien oder der Türkei kamen. Zum Beispiel die Geschichten der Autos, dem wichtigsten Statussymbol für den Heimaturlaub. Gastarbeiterfamilien kauften keinen praktischen VW-Kombi. Sie sparten an Wohnen, Essen und Kleidung und kauften, wenn es irgend ging, einen Mercedes oder BMW. Sie wollten der Verwandtschaft in der Heimat beweisen, wie gut es ihnen in Deutschland ging.
Mein Vater fuhr sein Leben lang in Deutschland ein gebrauchtes Limousinen-Modell von Mercedes Benz in metallic-grün. Wenn er das Auto ersetzen musste, war es wieder ein metallic-grüner „Märsedes“.
Oder die vielen Karton-Stapel: Die meisten Eltern behielten die Original-Verpackung der ganzen Elektronik-Geräte, für den „temelli dönüş“, die endgültige Rückreise. Ich dachte immer, Kartons gehören zu jeder Wohnungen dazu wie Möbel. Ich erlebe immer wieder, dass viele Menschen heute gar nicht mehr wissen, wie genau das damals ablief mit den Gastarbeitern.
- Dass man sie nicht „reingelassen“ hat, um ihnen etwas Gutes zu tun, sondern dass sie „geholt“ wurden, weil Deutschland sie händeringend brauchte.
- Dass irgendwann das Rotationsprinzip aufgehoben wurde, weil die Wirtschaft darauf bestand und dass ich nur deswegen Deutsche geworden bin, weil Deutschland ein wirtschaftliches Interesse daran hatte, dass meine Eltern bleiben – nicht umgekehrt.
- Dass die meisten Gastarbeiter in katastrophalen Wohnverhältnisse lebten, mit überhöhten Mieten. Die Bremer Baubehörde erklärte ihre Unterbringung in Sammelunterkünften in menschenleeren Industriegebieten 1973 im Weser Kurier mit den Worten: „Südländer bleiben nun einmal gern zusammen.“
Heute müssen sich die ehemaligen Gastarbeiter und ihre Kinder Vorwürfe darüber anhören, wie integrationsunwillig sie seien und dass sie lieber in einer selbstgewählten Ghettoisierung leben würden. Das ist historisch falsch und nicht in Ordnung. Deswegen können Sie, die Eingewanderten, eine Brücke bilden zu den neuen Einwanderern. Denn Sie wissen, wie es ist, in diesem Land neu anzukommen. Welche Gefühle, Ängste und Unsicherheiten und Ungerechtigkeiten es mit sich mitbringt.
Der Journalist Günter Wallraff hat sich Anfang der 80er Jahre als Türke verkleidet, nannte sich Levent Siğirlioğlu, ein Name, den er selbst kaum aussprechen konnte. Mit Perücke und Schnurrbart sah er aus wie die Karikatur eines Türken, er imitierte einen türkischen Akzent und sprach Kauderwelsch, wenn er Türkisch reden sollte. Aber niemand hat es bemerkt.
Wallraff ist es damit gelungen, vielen Menschen die Augen zu öffnen, was es damals bedeutete, „Gastarbeiter“ zu sein. Zwei Jahre lang hat er für sein Buch „Ganz unten“ recherchiert und zusammen mit ausländischen Arbeitern versucht, Geld zu verdienen. Am Ende seiner Recherche war der Journalist völlig erledigt – und empört. Wallraff sprach von „Apartheid“ in Deutschland, er habe „mitten in der Bundesrepublik Zustände erlebt, wie sie eigentlich sonst nur in den Geschichtsbüchern über das 19. Jahrhundert beschrieben werden“. Menschen würden gedemütigt, ausgebeutet, menschenverachtend behandelt.
Die meisten unserer Eltern haben diese Lebensphase als sehr schwierige Zeit in Erinnerung. Das hat auch uns geprägt. Als Kind war ich nicht stolz darauf, Gastarbeiterkinder zu sein.
Aber ich bin es jetzt.
Gastarbeiter haben dieses Land nicht nur mit aufgebaut, sie haben es geprägt. In wunderbarer Weise, wie ich finde. Sie haben es herausgefordert, sprachlich, kulturell und menschlich. Das war nicht immer leicht, für beide Seiten nicht, aber sehr effektiv. Die Arbeitsmigranten der 50er und 60er Jahre haben dieses Land verändert. Umso bedeutungsvoller ist es, dass Sie heute diese Anerkennung vom Bürgermeister der Stadt bekommen.
Die Staatsministerin für internationale Kulturpolitik, Michelle Müntefering, hat 2019 ein Denkmal für ehemalige Gastarbeiter*innen gefordert. Ich finde das eine sehr gute Idee! Es sollte ein Ort sein, der sie würdigt und ihre Geschichte Geschichten erzählt. Aber das reicht natürlich nicht. Die Geschichten der Arbeitsmigrantinnen und -migranten, die als mutige Pioniere nur wenige Jahre nach dem NS-Regime nach Deutschland kamen, müssen auch in Schulbüchern und Museen erzählt werden, sie müssen im kollektiven Gedächtnis dieses Landes ankommen. Das gilt auch für die Fluchtgeschichten vieler Menschen, die heute in Deutschland zuhause sind.
Es ist daher wichtig, dass sich Kultureinrichtungen und Gedenkstätten mit ihrem Programm, ihrem Personal und dem Publikum für die Einwanderungsgesellschaft öffnen. Hier geht das Focke-Museum bemerkenswerte Schritte und wendet sich bewusst auch an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte.
***
Ich möchte heute nicht darüber reden, was Arbeitsmigranten für das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand in Deutschland gebracht haben. Sie haben zwar viel zum wirtschaftlich starken Deutschland von Heute beigetragen, aber ich finde so eine Nutzwertbetrachtung prinzipiell falsch. Ich möchte lieber darüber reden, wie Migration dieses Land verändert hat. Zum Guten.
Können Sie sich vorstellen, wie ihre Straße oder ihr Viertel aussehen würde, wenn es keine Migration gegeben hätte? Die Straße in der ich lebe, die Menschen, die bunten Geschäfte, das vielseitige Essen, die belebten Bürgersteige – alles ist geprägt von Migration. Migranten haben aus der deutschen Hauptstadt eine internationale Weltstadt gemacht. Viele Touristen kommen nicht nach Berlin, um die Reste der Mauer zu sehen, sondern weil sie eine spannende Zeit in einer aufregenden Stadt verbringen wollen.
Migrant*innen haben vor allem die Essgewohnheiten verändert: Das deutsche Nationalgericht heißt Döner, der beliebteste Veganer-Imbiss Falafel. In deutschen Supermärkten gehören rote Linsen, Bulgur und Ayran inzwischen zum Standardangebot im Regal. Meine Mutter sagt, als sie nach Deutschland kam, gab es im Lebensmittelgeschäft nur Kohl und Rüben. Knoblauch gab es zwar auch, aber er war unbezahlbar teuer.
Viele haben sich davon nicht entmutigen lassen. Manche „Gastarbeiter“ haben nach und nach Obst und Gemüse importiert und verkauft. Sie sind Unternehmer*innen geworden, haben Geschäfte eröffnet. Ohne sie hätte es viel länger gedauert, bis in Deutschland Tomaten, Auberginen und Zucchini auf den Teller kamen.
Außerdem haben Migranten das Zusammenleben verändert: in den 50er Jahren hat sich niemand zur Begrüßung umarmt oder Küsschen auf die Wange gegeben. Jetzt ist das bei vielen ganz üblich, fast so wie ein Frankreich.
Deutschland ohne Migration – das wäre ein komplett anderes Land, und wenn wir ehrlich sind, wäre es weniger schön. Umso wichtiger ist es, dass wir lernen, Einwanderung als positiven Aspekt unserer Geschichte zu betrachten.
Auch wir, die zweite und dritte Generation sind den Arbeitsmigranten von damals zu großem Dank verpflichtet.
Ihr habt schon damals gegen Diskriminierung und Rassismus gekämpft. Besonders beeindruckend sind Leute wie Mevlüde Genç, deren Familie in Solingen bei einem rechtsextremen Brandanschlag ums Leben gekommen ist und die daraufhin zur Menschenrechtsaktivistin wurde. Sie hat dafür einen Bundesverdienstorden vom Bundespräsidenten bekommen. Zu Recht. Wenn Sie mich fragen, verdienen viel mehr einen würdigenden Orden.
Wenn heute viele von uns eine gute Schulbildung haben, dann nur, weil unsere Eltern dafür gesorgt habt, dass wir es schaffen. Damit wir es einmal besser haben. Und wir haben es heute besser.
Viele von uns führen die Kämpfe für Gleichberechtigung und Chancengleichheit nun weiter, damit eure Enkel, unsere Kinder, es noch wiederum besser haben. Und wenn wir uns die Fortschritte ansehen, die Ihr erzielt habt, dann gibt das Zuversicht.
Deswegen ist es höchste Zeit, dass wir den Arbeitsmigrant*innen der ersten Generation für ihre Lebensleistung offiziell danken. Der Staat dafür, dass sie dieses Land mit aufgebaut und gestaltet haben, und wir Nachkommen dafür, dass sie alles für uns gegeben haben. In einem fremden Land, das inzwischen ihre Heimat geworden ist.
Danke!
Diese Veranstaltung wurde gefördert im Programm